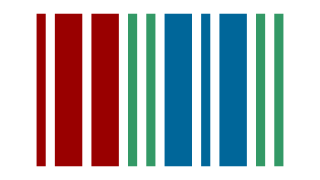| Dieser Beitrag wurde verfasst für das Symposium: “Open Humanities: Anwendungen und Grenzen offener Wissenschaftspraktiken in den Geisteswissenschaften” (04.07.2023), veranstaltet vom Open Science Center der LMU |
1. Maxime
Der einzig angemessene Ort für die Publikation öffentlich-rechtlich legitimierter Forschung ist das Internet unter Open Access-Bedingungen.
An dieser Leitlinie orientiert sich der Autor des vorliegenden Beitrags seit 2006 (vgl. AsiCa); sie wird in der Überzeugung befolgt, dass es im Interesse der Scientific Comunity wäre, wenn sich die persönliche Maxime als allgemeine Regel des Wissenschaftsbetrieb etablieren würde.1 Sie ist mittlerweile konform mit Vorgaben großer Fördereinrichtungen wie der DFG in Deutschland, des SNF in der Schweiz, der ANR in Frankreich und anderer, wenngleich die nationalen Unterschiede in der Umsetzung erheblich sind. So stellen der SNF und die ANR dauerhaft eingerichtete Publikationsplattformen zur Verfügung (vgl. https://data.snf.ch/ und https://anr.hal.science/), die den Open Data-Richtlinien entsprechen (vgl. Open Data Policy des SNF und https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/) und auf Dauer eingerichtet sind. In Deutschland gibt es dagegen die Initiative Text+; sie "startete offiziell im Herbst 2021 nach mehrjähriger Vorbereitungszeit und wird zunächst für fünf Jahre durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert". Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Nationalen Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI) also wiederum ein terminiertes Projekt; man kann nicht umhin, eine derartige Forschungspolitik als frivol zu bezeichnen.
2. Der mediale Aspekt
Forschung ist ihrem Wesen nach kollaborativ, denn es wird immer schon das bekannte Wissen vorausgesetzt. Voraussetzung ist die mediale Verfügbarkeit des Wissens. Das Medium der traditionellen Forschung ist die Schrift, insbesondere in ihrer mechanischen und industriellen Gestaltung. Sie wird sehr zu Recht als Typographie, deu. auch als Druckschrift bezeichnet: Die ursprünglich für die gedruckte Veröffentlichung entwickelte Gestalt der Buchstaben (die Glyphen) hat seit dem späten 19. Jahrhundert und dem Aufkommen der Schreibmaschinen die individualisierte Handschrift beinahe vollkommen abgelöst. Die sogenannten Manuskripte, die von Wissenschaftlern produziert wurden (und werden) sind Typoskripte, die mit einem typewriter, (vgl. zu deu. Type https://www.dwds.de/wb/Type 2), einer Schreibmaschine, erstellt wurden (vgl. Kittler 1985). Auch die ersten Generationen der privat genutzten Computer stehen noch ganz in dieser Tradition und werden weithin als komfortable Schreibmaschinen zur Herstellung vervielfältigungs- und damit publikationsfähiger Textvorlagen wahrgenommen und genutzt; man beachte übrigens, dass sich damit auch der Service der für die Publikation zuständigen Verlage substantiell änderte, denn die Korrektur wurde zunehmend, nicht selten vollständig an den Autor zurückgegeben. Die medialen Voraussetzungen für die Publikation werden damit auch in der Welt des Drucks seit geraumer Zeit – seit der massenhaften Verbreitung von Computern ab den 1980er Jahren – nicht durch den Verlag geschaffen. Die Wissenschaftsverlage haben zwar ein thematisches Profil, aber die inhaltliche Planung geben sie in aller Regel mehr oder weniger vollständig an Wissenschaftler in der Funktion von Herausgebern ab, insbesondere im Rahmen thematischer Reihen. Damit sind Verlage weitestgehend zu Vertriebsunternehmen geworden, die - und das ist im Hinblick auf die Publikation von grundlegender Bedeutung - den größten Anteil ihrer (ohnehin kleinen) Leserschaft keineswegs mehr mit ihren in kleinsten Auflagen gedruckten Objekten erreichen, sondern mit den davon derivierten digitalen Texten, die in der Regel im Format .pdf an zahlungswillige Großkunden, das heißt vor allem an Bibliotheken abgegeben werden.
Vor diesem Horizont ist das immer noch übliche Aufrechterhalten papierförmiger, in sich abgeschlossener Texte, die nach Seiten gegliedert und mit Fußnoten angereichert sind, eine anachronistische, wenn nicht bizarre Hybridlösung. Denn die beste mediale Grundlage der Forschung ist diejenige mit dem breitestmöglichen Kollaborationsangebot.
2.1. Ein anekdotisches Beispiel (aus eigener Erfahrung)
Es war einmal (mit emphatischem Präteritum) ein SFB an der LMU, der SFB 573: Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit (15. bis 17. Jahrhundert). Beteiligt waren Historiker:innen, Kunsthistoriker:innen, Philosoph:innen, Musikolog:innen Literatur- und Sprachwisenschaftler:innen. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Unternehmung (Projektnummer 5484562) war sehr erfolgreich, denn sie wurde einmal verlängert und hat eine durchaus stattliche Menge an Publikationen hervorgebracht, die teils ein kräftiges Echo erhielten (vgl. Übersicht). Dieser SFB ist nun im hier vorgegebenen thematischen Rahmen von Interesse, da in seine Laufzeit die mediale Revolution fiel, die sich mit den Schlagworten ‘Web 2.0’, ‘social media’ und ‘cloud’ identifizieren lässt.
Übrigens war der Autor dieses Beitrags in der zweiten Phase als Teilprojektleiter und Herausgeber involviert3; wenn also ein paar kritische Worte folgen, sind diese durchaus auch selbstkritisch zu verstehen. Gerade im Hinblick auf diese kritische Perspektive ist es wichtig daran zu erinnern, dass es sich um die Perspektive eines Sprachwissenschaftlers handelt. Das ist von Bedeutung, weil die Sprache ebenso wie andere kulturelle Techniken, nicht nur zur Wissenswelt der Expert:innen, d.h. der 'Sprachwissenschaftler:innen', gehört, sondern auch zu derjenigen der Laien, d.h. der Sprecher:innen.
Wenn nun jemand auf die – sinnvolle – Idee käme (vielleicht ein Leser?), die mehr oder weniger unmittelbaren Auswirkungen der medialen Revolution auf die geisteswissenschaftliche Forschungsarbeit zu untersuchen, so fände er in den Ergebnissen dieses SFB zweifellos ein geeignetes und lohnendes Objekt. Allerdings würde er/sie sofort feststellen, dass die medialen Errungenschaften in der Veröffentlichungspraxis des Großprojekts, das über ein eigenes Publikationsbüro verfügte, nicht das geringste Echo gefunden haben. Die zahlreichen Arbeiten wurden allesamt und ausschließlich in gedruckter Form veröffentlicht, zunächst, von 2003 bis 2009 beim LIT Verlag (Münster) und von 2009 bis 2015 bei De Gruyter (Berlin/New York).
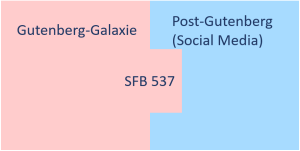
SFB 537 (LMU): Publikationen 2003 bis 2009 beim LIT Verlag (Münster) und von 2009 bis 2015 bei De Gruyter (Berlin/New York)
Es ist nun interessant und im Hinblick auf die Zurückhaltung der scientific community aufschlussreich, dass sich weder die massive Vermehrung von im Internet verfügbaren Primärquellen noch die vollständige Entfaltung des Internet als grundlegend neuer Form der Wissenskommunikation in Publikationen des SFB niedergeschlagen zu haben scheinen. Stichprobenhalber wurden die Bibliographien des ersten Bands (Oesterreicher/Regn/Schulze 2003) und diejenigen eines der letzten Bände (Friedrich/Brendecke/Ehrenpreis 2015) manuell ausgewertet. Hier das Resultat:
| Umfang | zitierte URL | |
| Oesterreicher/Regn/Schulze 2003 | 22 Art., 337 S. | 1 |
| Friedrich/Brendecke/Ehrenpreis 2015 | 10 Art., 249 S. | 7 |
Im einzigen Verweis in Oesterreicher/Regn/Schulze 2003 nennt ein Autor ein eigenes digitales Editionsprojekt (vgl. Schunka 2003, 336 und Fußn. 30, S. 331).
Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass eine Referenz, analog zu einer bibliographischen Referenz, die alleroberflächlichste Spur dieses Medium ist. Denn sie behandelt entsprechende Inhalte im Internet so, als ob sie gedruckt wären und nur in anderer Materialität – auf einem Display anstatt auf Papier – perzipiert und rezipiert würden. Ein solcher Umgang ist möglich und selbstverständlich legitim; er wird jedoch den wirklich revolutionierten, fundamental veränderten Rahmenbedingungen, unter denen mediale Öffentlichkeit und Wissenschaftskommunikation seither funktionieren, nicht einmal im Ansatz gerecht (vgl. Krefeld 2022c).
2.2. Verlag - Verleger - Verlegenheit
Die Zeit, in der die Publikation ganz wesentlich, wenn nicht ausschließlich, durch Druckverfahren (zunächst bewegliche Lettern, später vor allem Offset) erfolgte, wird seit McLuhan 1962b als Gutenberg-Galaxie bezeichnet. Während dieses Epoche verlieren jedoch die technischen Unternehmen, d.h. die eigentlichen Druckereien, zunehmend an Bedeutung, da sich ausgehend von den Druckereien die Verlage als eigenständiges Gewerbe etablierten. Verleger übernahmen das kaufmännische Risiko der Finanzierung, die Planung des Programms, die ästhetische Gestaltung sowie den Vertrieb und die Verbreitung der gedruckten Produktion. Ohne Verlag war in der Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert praktisch keine Veröffentlichung möglich. Den Weg des Selbstverlags beschritten nur wenige.4 Durch den technischen Fortschritt (zunächst elektrische Schreibmaschine, später PC) wurde die Herstellung und Gestaltung der Texte so vereinfacht, dass sie mit dem Schreibprozess zusammenfielen und somit von den Autor:innen selbst bewerkstelligt werden konnten, d.h.: mussten. Zudem wurden die Verfasser:innen wissenschaftlicher Literatur im Regelfall selbst in die Pflicht genommen die Finanzierung der Produktion zu garantieren. Das Verlagsgeschäft konzentrierte sich infolgedesssen so gut wie vollständig auf den Vertrieb der Bücher bei gleichzeitig und im Normalfall stark reduzierter Auflagenhöhe und entsprechend schwacher Sichtbarkeit.
Der Funktionsverlust der Verlage war also bereits stark vorangeschritten, als sich die Social Media (oder: Web 2.0) in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts sehr schnell und flächendeckend durchsetzten. Das gesamte Internet ist eine einzige gigantische Veröffentlichungsmaschinerie, auf die wir so gut wie überall und permanent (mit dem Handy) Zugriff haben; zu Recht bezeichnet man unsere aktuelle Gesellschaft daher als Wissens- oder Informationsgesellschaft (vgl. Krefeld 2020aa), die auch der unwichtigsten Information zu globaler Sichtbarkeit verhilft. In diesem Umfeld ist der Anspruch eines Verlags einen privilegierten Zugang zur Öffentlichkeit zu schaffen in rührender Weise aus der Zeit gefallen.
Die folgende Tabelle markiert einige Faktoren im Wandel des Publikationswesens; offensichtlich sind die Fortschritte in der Post-Gutenberg-Phase, denn die Social Media sind in mehrfacher Hinsicht multifunktional: Sie dienen der Produktion ebenso wie der Diffusion und erlauben gleichzeitig die Einbindung ganz unterschiedlicher Medien. Es ist unverkennbar, dass die Verlage in große Verlegenheit geraten sind.
| Prä-Gutenberg | Gutenberg-Galaxie | Post-Gutenberg | |
| Medium | (Manu)Skript | (Typo)Skript | |
| Bild | |||
| Film | |||
| Sound | |||
| Produktion | Autor | ||
| Kopist | Druckerei | Social Media | |
| Vertrieb/Diffusion | Skriptorium | Verlag | |
| Konservierungsverantwortung | Bibliothek | ||
| Einige Faktoren im Wandel des Publikationswesens | |||
3. Der ökonomische Aspekt
Universitäten sind in Deutschland Körperschaften öffentlichen Rechts (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts_(Deutschland) und als solche nicht berechtigt, ein gewinnorientiertes Gewerbe zu betreiben. Deshalb gibt es keine universitätseigenen, kommerziellen Verlage, wenngleich manche Verlage mit privatrechtlichem Status sich Universitätsverlag nennen). Vor diesem Hintergrund haben Universitäten eine selbstverständliche Affinität zur Open Access-Bewegung, denn es steht ihnen frei, Texte zu publizieren, genauer gesagt: die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wissenschaftlich relevante Inhalte öffentlich und mit verlässlicher Persistenz zur Verfügung gestellt werden. Mit der Entwicklung des Internet sind die technischen Anforderungen dafür vermutlich in allen staatlichen Hochschulen und Universitäten grundsätzlich zu bewältigen. Aber ein entsprechender Dienst erfordert Arbeit, die im Rahmen der vorhandenen Ressourcen (Mittel und Stellen) geleistet und finanziert werden muss. Eine entsprechende Praxis muss sich also idealerweise in den Arbeitsplatzbeschreibungen geeigneter Stellen abbilden oder mindestens damit verträglich sein. Auch eine internetbasierte Infrastruktur für die Publikation ist also ökonomisch, d.h. auf der Basis von Kosten und Nutzen zu bewerten. Für die ITG der LMU bedeutet das aktuell:
"einerseits die jährlichen Betriebskosten: Serverhardware, Storage, Ausstattung Serverraum, Strom, Netzinfrastruktur. Andererseits die Personalkosten (mit Raum, Strom usw.) für 2 x TV-L E10 mit geringen Zeitanteilen für die Server- und Softwarewartung und ebenso 2 x TV-L E13 mit geringen Zeitanteilen für Softwareentwicklung. Dann käme noch der Zeitaufwand für Korrespondenz, ggf. Schulung und Redaktion mit den Autoren dazu." (Auskunft von Christian Riepl, ITG der LMU)
Man könnte daher auf die Idee kommen weiterhin Verlage zu nutzen, um die universitären Kapazitäten nicht zu belasten; nicht zuletzt könnte die mittlerweile starke Online-Präsenz der kommerziellen Verlage als adäquate Option erscheinen, der medialen Herausforderung auch in Kooperation mit Verlagen zu begegnen. So präsentiert sich einer führenden, wenn nicht überhaupt der führende Verlag im Bereich der Sprachwissenschaften als "einer der größten unabhängigen Open-Access-Buchverlage" (De Gruyter). Diese Selbstdarstellung ist ein offenkundiger Widerspruch in sich selbst. Aber die Chuzpe, mit der das Label Open-Access für kommerzielle Zwecke instrumentalisiert wird, kann man nur als den Versuch einer feindlichen Übernahme des Ausdrucks qualifizieren, der mit der Bewegung, aus der er stammt, und mit der Konzeption, die der Ausdruck eigentlich bezeichnet, nichts mehr zu tun hat. Denn Ökonomie und Kommerz düfen keinesfalls gleichgesetzt werden.
Das kommerzielle Pseudo-Open-Access-Angebot ist:
- erheblich teurer als eine universitätsbasierte Open-Access-Lösung:
"Für Monografien und Sammelbände beginnen unsere Open-Access-Gebühren bei etwa 7.000€ (zzgl. Mehrwertsteuer). Zusätzliche Kosten hängen von publikationsspezifischen Parametern wie Umfang und Komplexität des Manuskripts sowie des Leistungsumfangs ab" (De Gruyter); - in seinen Prozeduren intransparent (Metadaten? vgl. Lücke/Schulz 2022; Repositorien?);
- nicht wirklich mediengerecht, da ohne aktive Nutzereinbindung;
- prekär, da es über keine persistente institutionelle Absicherung verfügt: Was passiert, wenn der Verlag insolvent geht?
4. Der forschungsethische Aspekt
Jede wissenschaftliche Publikation impliziert eine forschungsethische Positionierung des Autors/der Autorin, auch dann wenn sie als solche nicht reflektiert wird. Denn Forschung ist – wie bereits erwähnt – ihrem Wesen nach immer schon kollaborativ, da sie das bereits vorhandene und in medialer Gestalt thesaurierte Wissen voraussetzt. Die Intensität und Produktivität der Kollaboration sind unmittelbar vom gewählten Publikationsmedium abhängig: Sie zu optimieren gehört zum ethischen Auftrag der Forschung. Im einzelnen sind mindestens die Fragen zu beachten für wen und was publiziert wird.
4.1. Für wen wird publiziert?
In jedem Fall werden Forschungsergebnisse für die Scientic Comunity veröffentlicht. Im universitären Bereich gilt jedoch die Einheit von Forschung und Lehre, so dass der wissenschaftliche Fortschritt kontinuierlich in die Lehre einfließen muss. Darüber hinaus ist die Forschung ihrem Geldgeber verpflichtet; im Fall der öffentlich-rechtlich, nämlich durch Steuergelder finanzierten und legimierten Forschung darf deshalb grundsätzlich auch ein Transfer der Ergebnisse an die nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit erwartet werden. Es ist von vornherein klar, dass Web-Publikationen dieser (Heraus)Forderung substantiell besser entsprechen als Print-Publikationen, denn alle Zugangsschwellen, die mit der Magazinierung von Fachliteratur in wenigen Bibliotheken verbunden waren, sind im Internet entfallen. Der Transfer hat dadurch eine vollkommen neue Relevanz bekommen, so dass vom ‘dritten Auftrag’ (engl. third mission) der Universität gesprochen wird. Es ergibt sich das folgende Schema:
| Publikation in öffentlich-rechtlich legitimierter Forschung | ||||
| Forschung | ⇔ | Publikation | ⇒ | Lehre |
| ⇒ | Transfer (third mission) | |||
4.2. Was wird publiziert?
Während die Frage nach dem Publikum unter den Bedingungen des Medienwechsels ("Für wen?") mit Hinweis auf eine veränderte Relevanz der unterschiedlichen Adressatengruppen beantwortet werden kann, führt die Frag nach dem Inhalt zu gänzlich neuen Kategorien. Denn ein wissenschaftlicher Webauftritt liefert nicht nur Fachinformationen (oder: ‘content’), sondern den Code, mit dem Fachinformation strukturiert und internetfähig gemacht wurde. Hinzu kommen der Code und die Funktionalität der Web-Schnittstelle:
| Informativer Gehalt von Web-Publikationen | |
| Code | Schnittstelle | Content |
Im Hinblick auf den fachlichen Inhalt ist es weiterhin sinnvoll zwischen den Forschungsdaten im engeren Sinn, also dem Datenkorpus, einerseits und dem darauf basierenden analytischen Diskurs andererseits zu unterscheiden. Beide Bereich sind jedoch in genuinen Web-Publikationen eng miteinander verwoben
| Content | |
| Korpusdaten (Dokumentation) | Diskurs (Analyse) |
Eben der Verschränkung der beiden Content-Bereiche will die Publikationsplattform Korpus im Text (KiT) Rechnung tragen.
Zwar ist die Publikation der Korpusdaten im Sinne der Transparenz der Analyse ganz grundsätzlich, d.h. in allen Disziplinen notwendig. Ebenfalls obligatorisch für alle Fächer ist es, den wissenschaftlichen Content im Sinn der Disziplin zu kategorisieren und zu modellieren; Forschung ist in der Wissenswelt der Experten angesiedelt. Im einzelnen muss die Publikation jedoch die tiefgreifenden Unterschiede zwischen des Fächern und Fachgruppen berücksichtigen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften, die zunehmend als humanities und in der Perspektive des Medienwechsels als digital humanities apostrophiert werden, dokumentieren die Korpusdaten Kulturtechniken (Sprachen, Alltagswelten, Vergesellschaftungen usw.) und ihre Geschichte; sie werden, mit anderen Worten, aus der Lebenswelt der Laien extrahiert. Diese Laien sind jedoch gleichzeitig auch Informant:innen. Die Webtechnologie eröffnet nun den Universitäten/Hochschulen im Sinne der third mission die Möglichkeit die erhobenen und aufbereiteten bzw. analysierten Daten den jeweiligen Gruppen in medialer Repräsentation zu restituieren. So können z.B. in den Sprachwissenschaften die Sprechergemeinschaften im Internet leicht mit ihren ‘eigenen’ Daten konfrontiert werden, das war früher theoretisch möglich, aber praktisch weitestgehend ausgeschlossen. Im Horizont internetbasierter Forschungskommunikation (bzw. Publikation) sind nun in forschungsethischer Hinsicht zwei Effekt festzuhalten, die als epistemische Entfremdung/Alienation und mediale Aneignung/Appropriation identifiziert werden können.
4.2.1. Epistemische Entfremdung
Es ist unvermeidlich, dass diejenigen, die eine kulturelle Technik (z.B. einen Dialekt) verwenden (z.B. die Sprecher:innen), eben diese eigene Technik als mehr oder weniger fremd wahrnehmen, wenn sie im fachlichen Kontext beschrieben wird. Immerhin kann dieser Effet der epistemischen Entfremdung durch die Art der medialen Präsentation der Korpusdaten in nicht unerheblichem Maße gemildert werden, z.B. dann, wenn dialektale Materialien als Audiodaten wiedergegeben werden oder z.B. eine Handwerkstechnik als Videodaten. Beides garantiert unmittelbares Wiedererkennen und ist im Printformat ganz und gar unmöglich.
4.2.2. Mediale Aneignung
Vermeidlich ist dagegen in jedem Fall die weithin noch übliche verlegerische Praxis, sich die mediale Repräsentation von Forschungsdaten anzueignen, wie es immer dann geschieht, wenn Autor:innen ihre Nutzungsrechte abtreten. Sobald das geschieht, werden den Informant:innen nicht nur die gelieferten Rohdaten genommen, sondern auch die Möglichkeit die aufbereiteten Daten im wissenschaftlichen Kontext einzusehen – es sei denn, sie erwerben die entsprechenden Publikationen. Da die Daten aber Teil der privatwirtschaftlichen Kommerzialisierung der Forschungsarbeit werden, handelt es sich emphatisch ausgedrückt um nicht anderes als um Ausbeutung der Informant:innen, die übrigens auf den kommerziellen Aspekt kaum (in der Regel: gar nicht) hingewiesen werden, wenn sie um ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Daten gebeten werden. Es wird in diesem Zusammenhang sehr klar, dass Printveröffentlichungen gerade nicht auf die Maximierung des Publikums zielen. In web-basierten Publikationen bleiben die Informant:innen dagegen mindestens potentiell in die Wissenschaftskommunikation eingebunden. Das Interesse innerhalb der untersuchten Gemeinschaften und womöglich auch bei ihren Nachkommen die Dokumentation ihrer jeweiligen kulturellen Techniken auch im wissenschaftlichen Kontext zu verfolgen und konsultieren darf vorausgesetzt werden. Aus eigener Erfahrung folgen abschließend 3 von etlichen E-Mails, die der Verfasser als Echo auf ein gemeinsames Projekt mit Stephan Lücke, den Audioatlas siebenbürgisch-sächsischer Dialekte, erhalten hat (vgl. ASD):
"Am 2022-06-16 17:37, schrieb nn1:
Sehr geehrter Herr Krefeld,
ich bitte sie um den Zugang zum Adioatlas Siebenbürgisch-Sächsischer Dialekte, da ich selbst dieser Volksgruppe angehöre, aber leider kaum noch den Dialekt sprechen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
"Am 2019-09-17 18:54, schrieb nn2:
Sehr geehrter herr Krefeld,
Mein Name ist nn2, ich bin wohnhaft in xxx und
interessiere mich sehr für meine familiären Wurzeln. Ich bin Siebenbürger Sachse, der in der ersten Generation in Deutschland aufgewachsen ist. Das Soxxische konnte ich bis zum Kinderarten
fließend sprechen, jedoch habe ich mich danach geweigert und mit
meinen Eltern nur noch Hochdeutsch gesprochen. Verstehen tuhe ich alles, jedoch möchte ich meine Aussprache verbessern. Dazu könnte der ASD mir sehr weiter helfen. Darum wäre ich ihnen sehr dankbar
wenn sie mir die Zugangsdaten aushändigen könnten.
MfG, nn2"
"Am 2016-05-13 19:14, schrieb nn3:
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch einen Radiobericht im SWR2 bin ich auf den Audioatlas
Siebenbürgisch-Sächsischer Dialekte aufmerksam geworden.
Sehr gerne würde ich Zugriff auf die Audiodateien haben,da ich selber
siebenbürgisch spreche. Was muss ich dafür tun?
Viele Grüße aus yyy
nn3"
Bibliographie
- ASD = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (Hrsgg.) (2010-2013): Audioatlas siebenbürgisch-sächsischer Dialekte, München (Link).
- AsiCa = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (2006-2017): Atlante sintattico della Calabria, München, LMU (Link).
- FEW en ligne = atilf: Französisches etymologisches Wörterbuch (Link).
- Friedrich/Brendecke/Ehrenpreis 2015 = Friedrich, Susanne / Brendecke, Arndt / Ehrenpreis, Stefan (Hrsgg.) (2015): Transformations of Knowledge in Dutch Expansion, Berlin / New York, De Gruyter.
- Kant 1977 (= 2. Aufl. 1786) = Kant, Immanuel (1977 (= 2. Aufl. 1786)): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Werke in zwölf Bänden, vol. 7, Frankfurt am Main, 18-33 (Link).
- Kittler 1985 = Kittler, Friedrich (1985): Aufschreibesysteme 1800/1900, München, Fink.
- Krefeld 2020aa = Krefeld, Thomas (2020): Forschung in der Wissensgesellschaft, in: Lehre in den Digital Humanities, München, LMU (Link).
- Krefeld 2022c = Krefeld, Thomas (2022): Wissenschaftskommunikation im Web, in: Methodologie, VerbaAlpina-de 22/2 (Link).
- Krefeld/Oesterreicher/Schwägerl-Melchior 2013 = Krefeld, Thomas / Oesterreicher, Wulf / Schwägerl-Melchior, Verena (Hrsgg.) (2013): Reperti di plurilinguismo nell'Italia spagnola — Hallazgos de plurilingüismo en la Italia española, Berlin / New York, De Gruyter.
- Lücke/Schulz 2022 = Lücke, Stephan / Schulz, Julian (2022): Metadatenschema, in: Methodologie, VerbaAlpina-de 22/2 (Link).
- McLuhan 1962b = McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg galaxy. The Making of Typographic Man, London, Routledge & Kegan Paul.
- Oesterreicher/Regn/Schulze 2003 = Oesterreicher, Wulf / Regn, Gerhard / Schulze, Winfried (Hrsgg.) (2003): Autorität der Form — Autorisierung — Institutionelle Autorität, Münster, LIT.
- Schuchardt 1895 = Schuchardt, Hugo (1895): Sind unsere Personennamen übersetzbar?, Graz, Selbstverlag des Verfassers (Link).
- Schuchardt 1900 = Schuchardt, Hugo (1900): Über die Klassifikation der romanischen Mundarten. Probevorlesung gehalten zu Leipzig am 30. April 1870, Graz, Styria (Link).
- Schunka 2003 = Schunka, Alexander (2003): Autoritätserwartung in Zeiten der Unordnung. Zuwandererbittschriften in Kursachsen im 17. Jahrhundert, in: Oesterreicher/Regn/Schulze 2003, 323-337.
- Schwägerl-Melchior 2014 = Schwägerl-Melchior, Verena (2014): Sprachenpluralität und -autorisierung. Die Verwaltungskommunikation des spanischen Regno di Napoli im 16. Jahrhundert, Berlin / Boston, De Gruyter.
- Soares da Silva 2015 = Soares da Silva, Davide (2015): I ‘Ricettari di segreti‘ nel Regno di Sicilia (’400–’600), Berlin / Boston, De Gruyter.
- Wilhelm 2013 = Wilhelm, Eva-Maria (2013): Italianismen des Handels im Deutschen und Französischen: Wege des frühneuzeitlichen Sprachkontakts, Berlin u. a., De Gruyter.